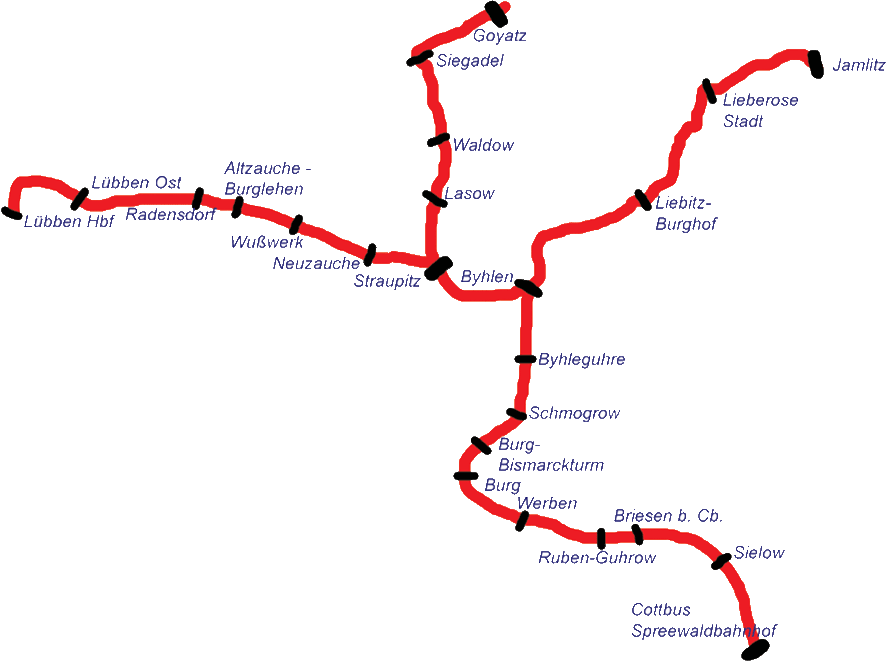
Auf ihrer letzten Fahrt am 3. Januar 1970 erreicht die Bahn von Werben kommend den Bahnhof Ruben-Guhrow

Foto: Walter Zimmermann, Ruben
Siehe auch Stog - Der Schober 2007
Mit der Bahn
durch den Berg – 1897
Geschichten aus
der Zeit, als man die Spreewaldbahn erbaute
Vor 2000 bis
3000 Jahren stand auf dem Burger Schlossberg eine bronzezeitliche
Befestigungsanlage, welche auf
die Lausitzer Kultur zurück gehen soll. Die letzte Burg vor etwa
1 000 Jahren baute dann die zuvor eingewanderte
slawische Bevölkerung. Der heutige Restberg stellt somit ein
Bodendenkmal allererster Güte dar. Schon „Stog 2006“ berichtete über die
archäologischen Ausgrabungen an seinem Fuß, die in Vorbereitung auf den
Bau der heutigen „Bismarckschänke“ erfolgten und über dabei entdeckten
Funde aus der Bronzezeit.
Der Berg hat sich
wohl seit dem Untergang der burgenbauenden Kulturen nur wenig verändert.
Doch in der Zeit des Industrialisierungsschubs in Deutschland und
der allgemeinen Eisenbahneuphorie vor etwas mehr als 100 Jahren, wovon
auch der Spreewald profitieren wollte, wurde er
„demoliert“.
Mitten durch den
Schlossberg führte man die Gleise der heute bereits wieder
verschwundenen Spreewaldbahn hindurch und benutzte den Sand des
Einschnittes am Berg für den Bau des Bahndamms nach Schmogrow.
Als der Bau der
Bahn begann, gab es bereits Gegenwind zum Durchschneidungsprojekt.
Am 12. April
1897 traf man sich in Burg am Schlossberg zu einer hochrangigen Beratung[1].
Anwesend waren der Geheime Ober-Regierungsrat Persius und der Geheime
Regierungsrat von Moltke aus dem Königlichen Ministerium der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, der Direktor
der vorgeschichtlichen Abteilung des Berliner Museums, Dr. Voss, der
Provinzial-Konservator für Brandenburg, Landesbaurat und Geheimer Baurat
Bluth, von dem königlichen Ministerium für die öffentlichen Arbeiten,
Geheimer Ober-Regierungsrat Francke, Geheimer Baurat von Dremming und
von der Regierung in Frankfurt an der Oder der Geheime Regierungsrat
Baudouin sowie der Geheime Baurat Kröhnke. Als Vertreter des Kreises
Cottbus nahm der Landrat
Freiherr von Wackerbarth und sein Amtskollege aus dem Lübbener Kreis,
Graf von der Schulenburg, an der Beratung teil.
Seitens der
Königlichen Eisenbahndirektion in Halle waren der Regierungs- und
Baurat Bischof, Regierungs-Assessor
Kosak und endlich der Bauunternehmer Becker nach Burg gekommen.
Sie trafen sich also an Ort und Stelle, um „die in Aussicht genommene
Durchschneidung des Schlossberges“ erneut zu diskutieren. Der
Unternehmer Becker hatte den Verlauf der Strecke anschaulich abgesteckt.
Zunächst erklärten übereinstimmend die Vertreter der Ministerien und der
Frankfurter Regierung, dass die abgesteckte Streckenführung rund 100
Meter vom westlichen Fuß des Schlossberges entfernt, „die Äußere
Gestaltung dieses altehrwürdigen Denkmals der Vorzeit wesentlich
beeinträchtigen“ würde. Es wäre möglich, dass man der abgesteckten
Linie, nach den im Protokoll näher genannten Gesetzlichkeiten, die
„landespolizeiliche Genehmigung versagen“ würde.
Sodann
diskutierten die Herren andere Streckenvarianten. So die Umgehung des
Berges an seiner östlichen Seite – was jedoch für alle Beteiligten wegen
„der sich an der Örtlichkeit und Kostspieligkeit der Ausführung ergebene
Schwierigkeiten nicht wohl in Betracht kommen könnte.“
Bliebe also nur,
die Strecke westlich um den Berg herum zu führen „unter Vermeidung
jeglichen Einschnittes“.
Das Veto kam nun
von Seiten des Landrats Graf von der Schulenburg. Die niedrig liegenden
Wiesen auf dieser Seite erfordern, bedeutende Erdmassen für den Bahndamm
aus weiterer Entfernung heran holen zu müssen. Der Bau würde sich um bis
zu 30 000 Mark verteuern. Und diese Verteuerung würde den „wenig
leistungsfähigen Kreis Lübben, auf dessen Kosten die Kleinbahn
hergestellt werden sollte, übermäßig belasten“. Der Kreis Cottbus war
aus der Beteiligung an diesem Bahnprojekt bereits ausgestiegen.
Dieser Einwurf
„erschien“ den anderen Konferenzteilnehmern „nicht ungerechtfertigt“.
Auch Unternehmer Becker hatte Argumente gegen die westliche Linie. Der
Schlossberg befinde sich im Privateigentum, an dem er sich das
Vorkaufsrecht gesichert habe, und es gebe keinerlei gesetzliche
Bestimmung, „auf Grund deren die Entnahme von Erde aus dem Schlossberg
gehindert werden könnte“. Er könne nicht garantieren, dass der Berg
erhalten bliebe, auch wenn die Kleinbahn herum geführt werden sollte.
Man versuchte
einen Kompromiss zu finden zwischen den Unternehmerinteressen einerseits
und dem Bemühen, „die Gesamterscheinung [des Berges] thunlichst wenig zu
beeinträchtigen“, und seinen Bestand auf Dauer zu erhalten.
Da die Umwallung des Berges 55 bis 60 Meter weiter östlich des ursprünglich gedachten Durchstichs bereits stark in der erforderliche Breite abgetragen war, leicht ansteigende Böschungen vorhanden waren, über die ein „Fahrweg“ führt, entschied man sich, die Bahnstrecke hier durch zu legen. Dem Unternehmer solle die Entnahme von Erde auf der durchschneidenden Strecke gestattet werden, wenn er gleichzeitig versichere, die übrigen Teile des Schlossberges in ihrem ursprünglichen Zustande zu belassen. Der Unternehmer Becker erklärte sich dazu bereit.
Diese Strecke
wurde schließlich gebaut und brachte viele wertvolle, heute leider zum
Teil verschollene, archäologische Funde hervor.
© Rolf Radochla 2012
[1]
Eine Abschrift zum Aktenvermerk über diesen Vorgang
befindet sich im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Bestand 3B
der Regierung Frankfurt an der Oder,
Abt I Verkehr, Aktennummer 649.
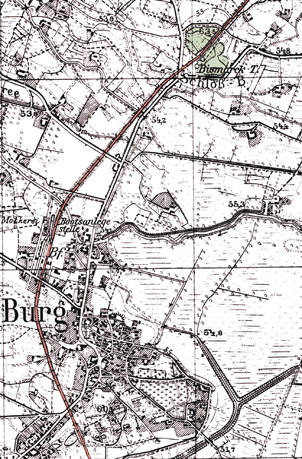
Dieser Beitrag erschien im
Stog - Der Schober 2012
Müller von Schönaich auf Werben – ein Gegner der Spreewaldbahn?
Geschichten aus der Zeit, als man die
Bahn erbaute
In seiner Chronik der
Spreewaldbahn stellt Harald Großstück 1988 ( Seite 8) fest, „ Die
meisten Gegner (des Bahnbaus) waren im Landkreis Cottbus versammelt ...
Der Kreistag beschloß am 18. August 1896, den Bau nicht zu unterstützen
... Der Major (a.D.) Müller von Schönaich – Werben
sprach von Überschwemmungsgefahr,
Dorfdurchtrennungen, Feuergefährlichkeit und Durchschneidung von
Gutshöfen ... Man wollte mit allen Mitteln den Bau verhindern, was
offensichtlich zu einem Kleinkrieg gegen die Bahn führte.“
Zwei dicke Aktenbände
im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Rep 3 B Regierung Frankfurt
a./O. Nr. 649 u. 650 Abt. I Verkehr, aus jener Zeit des Bahnbaus
scheinen diese Ansicht zu stützen.
Da gibt es eine
Beschwerde an das Cottbuser Landratsamt von dem Major a.D., weil der
Bauunternehmer des Bahnbaus auf einem Grundstück nahe dem
Guhrow-Werbener Wege (Sand-Gruben-Terrain genannt) eigenmächtig Material
für den Bau des Bahndammes entnommen und dabei auch einige Kiefern
beseitigt habe und nun ihm und den anderen Besitzer „selbstredend“ eine
Entschädigung zustehe. Eine weitere Beschwerde mit ähnlichem Inhalt
legte Bernhard Kruschwitz im Namen des Gemeindekirchenrates vor. Es gab
jedoch eine Absprache zwischen dem Bahnbau-Unternehmen und dem Werbener
Ortsvorsteher (Bürgermeister) zur Nutzung des Terrains
zum Preis von 150 Mark.
Worum ging es? Dieses
Grundstück war offensichtlich die Kiesgrube für Werben. In der
Separation wurde sie weder verzeichnet noch benannt, im Grundbuch steht
die Fläche ebenso nicht drin und auf Katasterkarte ist es als
Gemeinbesitz aller Dorfbewohner bezeichnet.
Der meiste Kies daraus wurde wohl für die
Reparaturen und Bauten der Kirche,
der Schule und der Küsterei verwendet
wurde, war aber auch sonst allen anderen Dorfbewohnern zugänglich.
Jedoch hatte sich eingebürgert, das Grundstück als zur Kirche gehörig
anzusehen, deren Patron zu dieser Müller von Schönaich hieß. Deshalb
erkannte der Genannte die Abmachung der Bahn mit dem Ortsvorsteher nicht
an.
Landrat von
Wackerbarth schlug dem Regierungs-Präsidenten in Frankfurt a.O. vor, die
Beschwerde „pure“ abzuweisen: „Die Behauptung des Majors a.D. Müller von
Schönaich, das keinerlei Abkommen mit den Beteiligten getroffen sei, ist
unrichtig.“ Die Beschwerde als solche bezwecke „lediglich eine Hinderung
des Bahnbaus. Auch der Kirche oder Schule steht m.E. (des Landrats) ein
Eigentumsrecht nicht zu … Die Bahneigentümer hatten demnach
nur mit der Gemeinde, nicht mit den
einzelnen Nutzungsberechtigten zu varhandeln…“
In einer weiteren Beschwerde vom 19. Juli 1989
geht es dem Major a.D. Müller von Schoenaich vor allem um den
Hochwasserschutz. Seine Argumentation zielt vor allem auf die Vorflut im
Bereich des Leineweber-Fließes, an dem zwischen Burg und Werben
umfangreiche Überflutungsflächen liegen – nebenan auf der Skizze von
Beschwerdeverfasser bildlich dargestellt.
Erstens seinen einige
Gräben (z. B. Skizze Graben B) völlig vernachlässigt, wogegen der
Gemeindevorsteher wenig getan habe.
Die
Burger hätten zweitens den Grenzgraben (A.) um circa ½ Meter hoch
verwallt. Ein weiterer Abzugsgraben zwischen dem neuen Bahndamm und dem
Feldwege daneben sei völlig verfallen. Viertens sei auf der nördlichen
Seite des Bahndammes gar kein Graben angelegt und es gäbe nur einen
einzigen Röhrendurchlass von 30 bis 40 Zentimeter Durchmesser durch den
Damm, der auf keinem Fall bei Hochwasser ausreichen würde. Im Fazit ist
der Major der Meinung: Durch die im vorigen Jahr (1897) stattgehabten
Überschwemmungen ist zur erwiesen, dass die Hochwasser durch den
Bahndamm vorgestaut werden und sich nicht mehr über das bisherige
Überschwemmungsgebiet bis zur Chaussee reichend, ausbreiten kann. Die
Einführung von Flutöffnungen bei der Station 359 und 361 der Bahntrasse
seine unbedingt erforderlich. Da zusätzlich die Chausseebrücke bei Burg
zu schmal und zu niedrig sei, steht das Hochwasser an der Straße 1 ½
Meter und darüber hinaus hoch.
Stog - Der Schober 2012
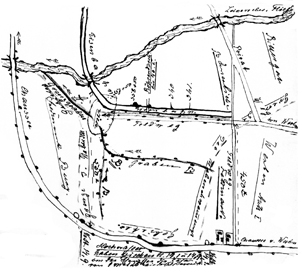
Skizze der Beschwerdeführer um
Müller von Schönaich zu Werben
gegen den Bahntrassenverlauf am Leineweberfließ vor Burg;
Quelle BLHA wie oben
Das Heu und die Flut
Saccasne
Ja, die Spreewaldbahn brachte den Verkehr in
Schwung, rückte den Spreewald an die allgemeinen Entwicklungen heran,
förderte Handel und Tourismus. Alles Positive Auswirkungen auf unsere
Region. Aber es ist nun einmal auch so, dass jeder Fortschritt ebenso
Nachteile gebiert. Der Bahndamm durch den Spreewald änderte an vielen
Stellen den gewohnten Jahresablauf, die normalen Hochwässer, mit denen
die Spreewälder jahrhundertelang lebten, breiteten sich nun ganz anders
aus als vorher. Wassermassen wurden an einer Seite des Bahndammes
aufgehalten und fehlten auf der anderen. Müller von Schönaich auf Werben
forderte ja gerade deshalb größere Flutöffnungen im Bahndamm, um die
alten Flutverhältnisse, die man im Wesentlichen beherrschte, wieder
herzustellen.
Ein ähnliches Problem gab es in Saccassne. Das
Fließ „Mocksche Brod“ oder „Broda“ trat regelmäßig im Winter und
Frühjahr über die Ufer und überschwemmte die niedrig liegenden Wiesen.
Dann kam der Bahndamm. Der sperrte die nördlich gelegenen Wiesen vom
Wasser ab. Ortsvorsteher Ketzmerick in Saccasne besaß genau dort seine
Wiese, die, wie er zu Protokoll gab im Cottbuser Landratsamt, so
beschaffen sei, dass sie die Hochwässer aus dem Fließ brauche, damit
ausreichend und qualitativ gutes Heu geerntet werden könne. Ketzmerick
sprach von einer Wertminderung der Wiese und fordert dafür Entschädigung
oder eine große Flutöffnungen im Damm, die die alten Flutverhältnisse
wieder herstellt. Da man ihm diese Wertminderung nicht zugestehen wollte
rechnete er vor: „… der Verlust beträgt in dem vergangenen Erntejahr
mindestens 12 – 15 Centner. Bei fortgesetzter Entziehung des Wassers
würde sich der Ertragsausfall noch erhöhen. Die mir hier durch
erwachsene jährliche Vermögensschädigung beläuft sich auf mindestens
40-50 Mark…“
Die Gegenseite hatte weiter argumentiert, das
seine Wiese doch weiterhin vom „Mockschen Brod“ bewässert werde. Das sei
eine falsche Behauptung, kontert Ketzmerick, „… sie läßt eine völlige
Unkenntnis … der bestehenden Verhältnisse..“ erkennen. Zwischen seiner
Wiese und dem Fließ liegt eine höhergelegener Acker, der gerade dies
verhindert, wie seine beigefügte Skizze verdeutlichen soll.
Offensichtlich hat diese Beschwerde zu Nichts
geführt. Doch Ketzmerick gibt so schnell nicht auf. Eine zweite gleichen
Inhalts wird kurz danach protokolliert. Ketzmerick bietet
Gesprächsbereitschaft und regt die Begutachtung durch Sachverständige
an. Er benennt vierzehn Zeugen, die alle seine dritte Beschwerde mit
unterzeichnen und seine Kernaussage stützen: Der Bahndamm entzieht
seiner Wiese das jährliche Hochwasser, was zur Ertragsminderung führt.
Leider schweigen die Akten im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv darüber, wie der Streit entschieden wurde.
Stog - Der Schober 2013
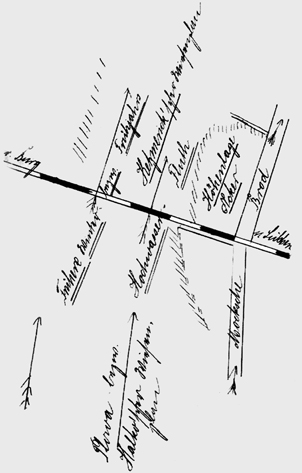
Das Rüttelgrundstück
Byhlen
Es war einmal ein gewisser „Anbauer“ Gallko, der
mit seiner Frau auf einem kleinen Hof mit Wohnhaus, Stall und Backofen
besetzt, abseits von seinem Dorfe Byhlen lange Zeit ruhig und
beschaulich lebte. Zu den Dorfversammlungen, auf denen die Neuigkeiten
und Bestimmungen bekannt gemacht und Verhandlungen geführt wurden,
gingen die beiden meist nicht hin. Und so störte sie auch so manche
Erregung nicht, die der Neuerungen wegen im Dorfe entstanden.
Doch eines Tages kam
die Neuerung zu Ihnen und hinterließ tiefe Spuren im Sand:
Eisenbahngleise der Lübben-Cottbuser-Kreisbahn. Eines führte von
Straupitz
nach Lieberose und ein anderes zweigte
nach Byhleguhre ab, beide nahe dem Gallkoschen Grundstück.
Nun hatte Gallko triftige Einwände gegen den
Bau. Mit einer Eingabe wurde er im Oktober 1898 abgewiesen — natürlich,
weil er an den Verhandlungen in seiner Gemeinde nicht teilnahm und
demzufolge seine Einwände in der gesetzlichen Frist noch gar nicht
bestanden.
Nun aber lagen nicht nur Gleise, sondern fuhren
auch die ersten Züge, um zum Weiterbau der Strecke Lehm, Kies und
anderen Materialien an die Bahnbaustelle zu bringen. Immer vorbei an
Karl Gollkos Haus, Stall und Backofen mit den „schwer beladenen Zügen“,
wie Gallko in einer zweiten Beschwerde vom 7. Februar 1899 schrieb, „
... durch deren Erschütterung mir bis jetzt unübersehbarer Schaden
zugefügt wird, an Mauerwerk und Ziegeldach.“ Ständig fiel Mörtel vom
Dach, bröckelte es aus den Fugen der Wände.
Der Beschwerdeführende forderte Schadenersatz,
behauptete von der Planfestsetzung nichts gewusst zu haben und
beantragte eine „Ueberzeugung an Ort und Stelle“.
So rückte Ende desselben Monats der Direktor vom
Amt Straupitz, Graf Homrath und der Ortsvorsteher Melcher bei Gallkos
an, um die Lage zu prüfen. Anwesend war aber nur Frau Gallko. Was der
Graf zu sehen glaubt schrieb er später nieder:
„Das massive Haus steht 14 Meter von den
Eisenbahngleisen entfernt, es steht circa 25 bis 26 Jahre … die Wände
des Hauses sind schwach und scheint bei dem Neubau desselben besonders
schlecht bindender Kalk verwendet worden zu sein. Die Wand der
Wetterseite zeigt einige Risse…, welche bei Gebäuden von schlechter
Beschaffenheit häufig zu beobachten sind. Besonders leidet das Dach des
Hauses, wo sich der verwetterte Kalk löst und herab bröckelt Eine
Beeinträchtigung durch die Eisenbahn liegt hier nicht vor“, es sei denn,
„daß durch die schwache Rüttelung der vorüberfahrenden Züge, der sich
bereits gelöste Kalk vom Dach herunter fällt.“
„… der vor 15-16 Jahren erbaute Stall besteht
aus Fachwerk und hat auffallend schwache Wände, besonders schwach sind
die beiden oberen Theile der Giebelwände, welche in Folge ihrer wenigen
Tragkraft unter der schweren Ziegelbedachung aus ihrer Lage getreten
sind. Eine Beeinflussung … durch das Fahren der Eisenbahn (liegt)
ebenfalls nicht vor“. Eine Beeinträchtigung hat also „ bisher nicht
vorgelegen, kann aber nach einiger Zeit eintreten, weil die schon
gänzlich aus ihrer Lage gedrängten Giebel durch die geringste Rüttelung
nachgeben und schließlich gänzlich herausfallen werden.“ Der Stall ist
26 ½ Meter von den Gleisen entfernt.
Und der Backofen, acht
Meter von der Bahn entfernt,
habe zwar einige Risse, diese können
aber auch nicht von der Bahn verursacht worden sein.
Was jedoch die Einladung zur
Planfestsetzungs-Diskussion in der Gemeindeversammlung betrifft, bekam
der Ortsvorsteher Melcher nach seinem Befragen wohl „rote Ohren“. Er
hatte Gallko wohl doch nicht eingeladen, weil „der Beschwerdeführende …
keine Grundstücke (habe), welche an den Bahnkörper angrenzen und konnte
er bei dem Bahnbau keine Einwände erheben.“ Und tatsächlich verläuft
zwischen Gollkos Grundstück und der Bahn noch eine „Trift“.
Gallkos Einwände wurden erneut abgewiesen. Nicht
bekannt ist, ob die „schwachen“ Gebäude dort vor der Zeit zusammenfielen
und Gallko eventuell unter sich begruben. Die wieder eintretende Ruhe
nach der Einstellung der Spreewaldbahn wird er wohl trotzdem nicht mehr
erlebt haben.
Stog - Der Schober 2013
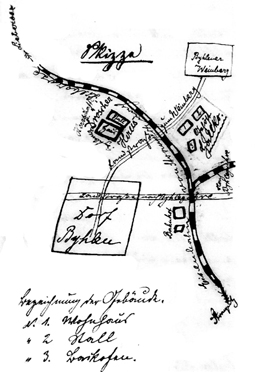
Ruben-Guhrow
Mühlenverpächter und Landwirt Christian Quetk hatte in Guhrow ein Grundstück an der Chausseekreuzung Cottbus-Burg mit der Straße Ruben-Guhrow für 13 000 Mark gekauft, welches mit mehreren Scheunen und, wie er sagte, mit einem Gast- und Wohnhause bebaut sei.
Als man die Spreewaldbahn zwischen Burg und Cottbus zu bauen begann, bemerkte Quetk im Planfeststellungsverfahren, dass diese in der Gemarkung Guhrow entlang der Chaussee und somit direkt über sein Grundstück am Wohnhaus vorbei geführt werden sollte.
Zunächst erhob er Einspruch und forderte, die Bahntrasse über unbebaute Grundstücke zu legen, da man so auch nach Briesen käme. Die Strecke wurde jedoch nicht geändert.
Zu den ersten Verhandlungen der Bahnunternehmer mit den Grundstücksbesitzern erschien Quetk nicht. Deshalb wurde er per Kreisblatt nochmals dazu aufgefordert unter Androhung einer möglichen Enteignung (Stog 2009, S. 110).
Im April 1898 kam es dann doch zu Verhandlungen mit Christian Quetk. Er genehmigte den Bau der Bahnstrecke auf seinem Grundstück, erhob aber hohe Forderungen zur Entschädigung: Einen gepflasterten Überweg zu seiner Haustür und zwei gepflasterte Überfahrten zu seinem Hof von der Chaussee aus über die Gleise, eine Mark für jeden in Anspruch genommenen Quadratmeter seines Grundes – insgesamt waren wohl um 4 900 Quadratmeter für die Bahn vorgesehen – sowie 3 000 Mark Entschädigung für die durch den Bahnbau entstehende Wertminderung seines Grundstückes.
Seine Forderungen wurden im Termin protokolliert, was Quetk sogleich dahingehend interpretierte, dass seine Forderungen diskutierbar wären. Aber das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Der Lübbener Kreisausschuss als Bauherr sagt: „Unannehmbar!“ – und leitet das Enteignungsverfahren ein, was man Quetk sofort mitteilte.
Die Felle begannen für ihn davon zu schwimmen. Da hört der Betroffene von Verhandlungen des Kreisausschusses mit der Berliner Bank über den Verkauf der Spreewaldbahn. Quetk griff nicht zum vermeintlich rettenden Strohhalm sondern zur Schreibfeder, weil er glaubte, in der Berliner Bank einen neuen Verhandlungspartner gefunden zu haben, und er bot ihr sein Gehöft mit allem Drum und Dran für 12 000 Mark zum Kauf an und zwar als Bahnhofsgebäude für den Haltepunkt „Ruben-Guhrow“.
Als von dort keine Antwort erfolgte, wandte sich Quetk an die Frankfurter Regierung, trug in einem weiteren Schreiben seine ursprünglichen Forderungen und das Berliner-Bank-Angebot nochmals vor. Er behielt sich aber vor, den Bahnbau mit allen Mitteln zu hindern, falls man nicht auf seine Forderungen eingehe. Was man natürlich nicht tat.
Der Regierungs-Präsident ließ dem Quetk über den Landrat wissen, dass der Enteignungsprozess gegen ihn vorangetrieben werde und er im Übrigen jegliche Bahnbauhinderungen zu unterlassen habe.
Intern amüsiert man sich über Christian Quetk. Der Lübbener Landrat teilt dem Regierungs-Präsidenten ein weiteres Detail mit: „… der von ihm [Quetk] selbst gezahlte Kaufpreis ist nach seiner eigenen Angabe nur durch die Vorspiegelung erzielt worden, auf dem Grundstücke ruhe eine Schankkonzession…“ Das hatte Christian während der Aprilverhandlungen blauäugig ausgeplaudert. Seine Forderung: „Ich will an dem Grundstücke Nichts verdienen – geschädigt will ich aber auch nicht werden!“, kam zu spät und richtete sich an die falschen Leute, er war bereits beim Grundstückskauf geschädigt und betrogen worden.
Stog - Der Schober 2013

Die Bahnstation Ruben-Guhrow
in den 30er Jahren
Foto: Walter Zimmermann, Ruben